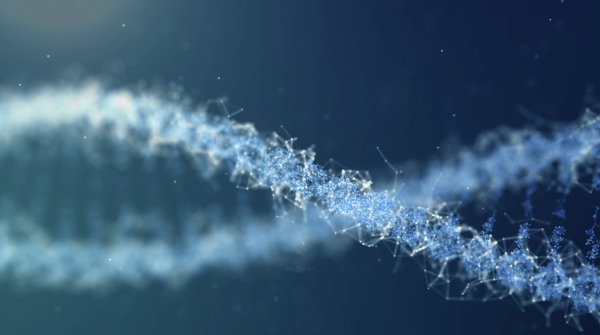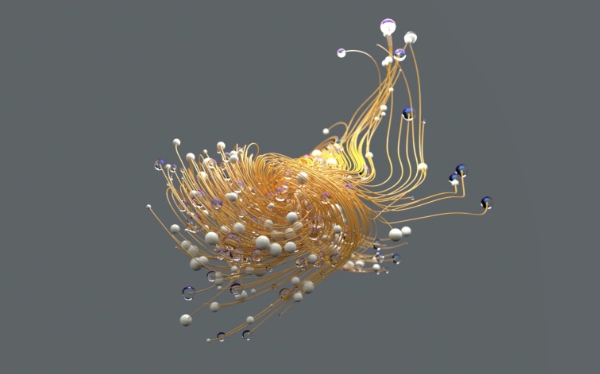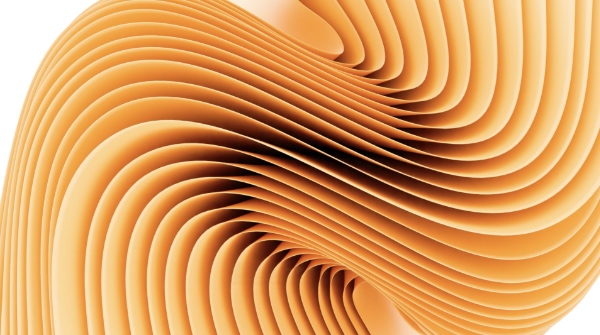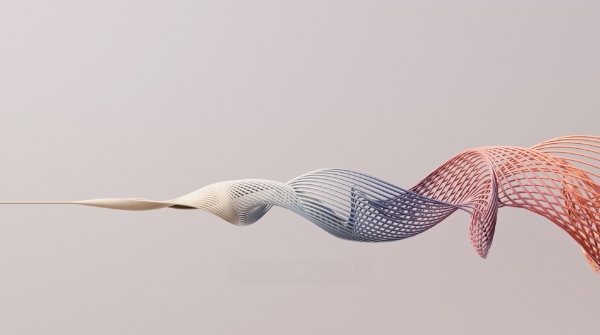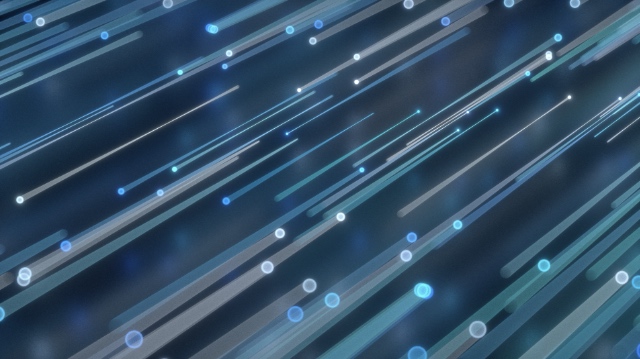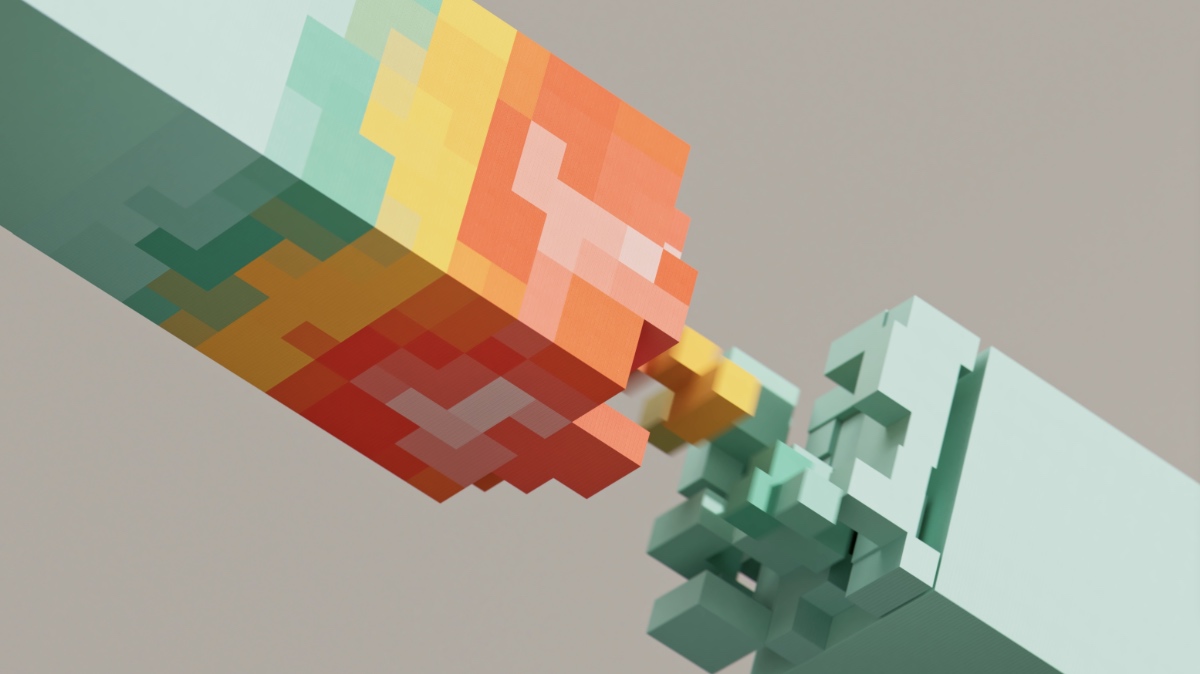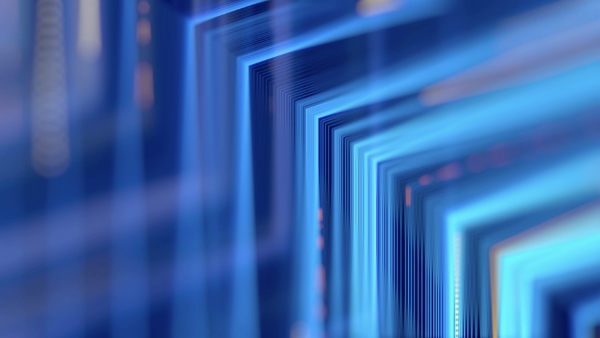Die Fashion- und Lifestylebranche steht unter massivem Druck: Margen, Nachfrage und Marktstrukturen verändern sich rasant. M&A-Transaktionen, Carve-outs und operative Transformationen gewinnen an Bedeutung. Im Fokus des Executive Dialogs von Dr. Wieselhuber & Partner (W&P): Die zentralen Erfolgsfaktoren von M&A-Prozessen. Die Branche ist geprägt von Saisonalität, kurzen Trendzyklen und frühen Orderentscheidungen sowie strukturellen Herausforderungen wie hohen Lagerbeständen, eingeschränkter Flexibilität im stationären Handel und komplexen Lieferketten. Erfolgreiche Transaktionen erfordern ein klares Verständnis der Wertschöpfungskette und eine konsequente Fokussierung auf den strategischen Kern. Gerade Investoren müssen bereit sein, Chancen aktiv zu ergreifen und operative Verantwortung zu übernehmen. „Man muss sich trauen zu springen“, betonte Dr. Hubertus Bartelheimer, Mitglied der Geschäftsleitung bei W&P. Wer auf vollständige Sicherheit warte, verliere in dynamischen M&A-Prozessen wertvolle Zeit – entscheidend seien Tempo, Klarheit und konsequente Entscheidungen. Dr. Dominik Benner, CEO The Platform Group AG und Vorstand Benner Holding GmbH, zeigte, wie sich M&A als zentraler Wachstumstreiber etabliert hat. Gesunkene Bewertungen und eine deutlich reduzierte Bieterlandschaft eröffnen neue Opportunitäten, während sich die Bewertung zunehmend am EBITDA orientiert. Maßgeblich ist aus seiner Sicht die konsequente operative Weiterentwicklung nach dem Erwerb, etwa durch die Bündelung zentraler Funktionen und die Realisierung von Skaleneffekten. Gleichzeitig warnte er vor einer einseitigen Fokussierung auf Synergien: Auch Dysenergien wie kulturelle Brüche oder steigende Komplexität können den Transaktionserfolg maßgeblich beeinflussen. Philipp Trompeter, W&P Leiter Fashion, Lifestyle & Retail, verdeutlichte anhand des Praxisbeispiels SportScheck die Bedeutung eines belastbaren Investorenkonzepts im M&A-Prozess. Die Grundlage ist ein Transformationsprogramm, in dem die Wertsteigerungspotenziale detailliert und quantifiziert werden. Die Bewertung der Effekte erfolgt anhand von Benchmarks und Branchenexpertise, sodass diese der Due Diligence standhalten. „Ein Investorenkonzept muss die Brücke schlagen zwischen operativer Realität und finanzieller Bewertung – nur dann entsteht Vertrauen auf Investorenseite“, so Trompeter. Christian Dresen, W&P Senior Manager Restructuring & Finance, hob die zentrale Rolle der finanzwirtschaftlichen Modellierung hervor: „Die GuV-Modellierung ist das Herzstück jeder Transaktion – sie macht Potenziale nachvollziehbar und verhandlungsfähig!“ Ausgangspunkt ist die operative Basisplanung, in die die entwickelten Maßnahmenpakete integriert werden. Gerade in Distress-Situationen ist zudem eine differenzierte Abbildung insolvenzspezifischer Effekte erforderlich, um belastbare Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. W&P Senior Manager M&A Ante Jelavic stellte klar, dass ein erfolgreicher M&A-Prozess in der Krise eine vorgelagerte operative und finanzielle Restrukturierung voraussetzt. „Investoren kaufen keine Probleme, sie kaufen Lösungen“, weshalb konkrete Maßnahmen, adressierte Risiken und eine belastbare Zukunftsperspektive entscheidend seien, um Vertrauen in die nachhaltige Weiterentwicklung des Geschäftsmodells zu schaffen. Anhand der M&A Transaktion CLOSED, erfolgreich umgesetzt von W&P, zeigte Lothar Hiese, geschäftsführender Partner MSP Management Support Partners GmbH & Co. KG: Eine starke Marke kann ein wichtiger Erfolgsfaktor sein, ersetzt jedoch keine betriebswirtschaftliche Solidität. Prozessexzellenz und Transparenz seien die Grundlage für Geschwindigkeit, Working Capital Management, Digitalisierung und leistungsfähige IT-Systeme dabei zentrale Hebel. In der abschließenden Werkstattdiskussion wurde deutlich: Der M&A-Markt ist anspruchsvoller geworden, viele Unternehmen enden mittlerweile in Stilllegungen oder mehrfachen Insolvenzen. Moderator und W&P Partner Volker Riedel betonte entsprechend die Bedeutung kultureller Integration und warnte: „Synergien sind oft scheue Rehe, die bei kleinsten Störungen verschwinden.“ Gerade im stationären Handel leiden viele Unternehmen unter rückläufiger Frequenz und sinkenden Umsätzen, wodurch finanzielle Mittel fehlen, um in E-Commerce, Omnichannel-Strukturen und moderne IT zu investieren: „Viele Unternehmen wissen, was zu tun ist – ihnen fehlt jedoch die finanzielle Kraft, die notwendigen Transformationen konsequent umzusetzen“, so Philippe Piscol, W&P Partner M&A. Fazit: Erfolgreiche Transaktionen in der aktuellen Marktphase gelingen nur dann, wenn operative Restrukturierung, finanzielle Transparenz, technologische Weiterentwicklung und eine klare Führungsperspektive zusammengedacht werden. Entscheidend ist ein belastbares Zukunftsbild, das Investoren überzeugt und Organisationen Orientierung gibt.